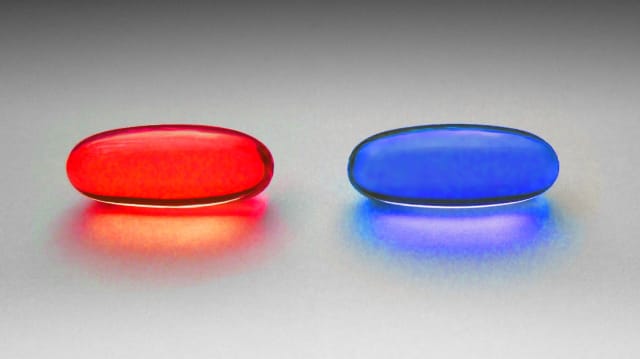Die Zahlen aus der Universität Bern haben es in sich – immerhin stehen sie im offensichtlichen Widerspruch zu einer Aussage, welche der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit erst kürzlich gemacht haben.
Die Feststellung damals: Die direkte Medikamentenabgabe durch Ärzte verteuert die Krankenkassen-Kosten nicht – im Gegenteil.
7'500 Arztpraxen aus der Deutschschweiz
Die Aussage des neuen «Working Paper» aus dem Volkswirtschaftlichen Institut der Uni Bern jetzt: Doch – Ärzte mit Dispensierrecht verursachen höhere Medikamentenkosten als Ärzte in jenen Kantonen, wo die Abgabe verboten ist.
Die Ökonomen
Daniel Burkhard,
Christian Schmid und
Kaspar Wüthrich untersuchten dazu Zahlenreinen aus den Jahren 2008 bis 2012: Sie massen Unterschiede, die sich bei 3'918 Allgemeinpraktikern und 3'488 Spezialisten in der Medikamentenverschreibung abzeichneten – und zwar in jenen Deutschschweizer Kantonen mit Selbstdispensation im Vergleich zu jenen ohne Selbstdispensation.
Daniel Burkhard, Christian Schmid, Kaspar Wüthrich: «Financial incentives and physician prescription behavior: Evidence from dispensing regulations», Discussion Paper, Universität Bern, November 2015
.
Das Ergebnis: Wenn der Hausarzt das Mittel gleich selber abgeben konnte, waren die Durchschnittskosten aller pro Patient verschriebenen Arzneien um 56 Franken höher (was wiederum etwa 26 Prozent der Medikamentenkosten ausmachte). Bei den Spezialisten war der Graben nicht ganz so breit – hier belief sich das Plus auf 16 Franken beziehungsweise 10 Prozent.
Dabei erklären sich die Differenzen fast vollständig mit der Menge und nicht aus den Preisen. Beim Beispiel der Hausärzte spiegeln sich die um 26 Prozent höheren Medikamentenkosten in um 28 Prozent häufigeren Abgaben von Arzneien.
Kostenkontrolle über die Menge, nicht über den Preis
Oder anders gesagt: Wenn ein Praxisarzt Medikamente abgeben darf, wählt er nicht etwa teurere Stoffe – aber er gibt tendenziell öfter ein Arzneimittel ab.
Hier sichten Burkhard, Schmid und Wüthrich auch den bedeutsamsten Punkt für politische Folgeaussagen: Die relative Bedeutung des Volumenaspektes «deutet an, dass eine Politik, welche die Mengen reguliert, zur Kontrolle der Gesundheitskosten erfolgreicher sein dürfte als Preisregulierungen.»
Menge oder Preis? Hier ergänzen sich die neuen Daten mit den Erkenntnissen, die die Bundesbehörden im Mai zum selben Thema vorlegten. «Ob Arzneimittel vom Arzt direkt abgegeben oder über eine Apotheke bezogen werden, hat auf die Gesamtausgaben der obligatorischen Krankenpflegeversicherung keinen Einfluss»,
hatte das Bundesamt für Gesundheit damals gemeldet – unter Berufung auf eine Studie, die das Institut Polynomics zusammen mit Helsana durchgeführt hatte.
Ärzte geben eher Generika
Denn auch jene Daten besagten, dass die Ärzte bei der Direktabgabe nicht teurere Medikamente abgeben: Die Patienten, so das BAG damals, «erhalten namentlich mehr verschiedene Medikamente und häufiger preiswerte Generika». Einen Unterschied sichteten die Autoren darin, dass Patienten der Selbstdispensations-Ärzte offenbar mehr ärztliche Sprechstunden in Anspruch nehmen.
Interessant zu prüfen wäre es also, wie sehr sich hier andere Faktoren im selben Phänomen spiegeln – insbesondere die Tatsache, dass selbstdispensierende Ärzte eher in ländlichen Regionen beziehungsweise Kantonen tätig sind.
Dennoch: Die vom Bundesrat im Mai publizierte Aussage, «dass Patientinnen und Patienten, die die Medikamente direkt vom Arzt oder der Ärztin erhalten, geringere Arzneimittelkosten zulasten der Krankenversicherung verursachen» – diese Aussage lässt sich jedenfalls so nur schwer halten.
- Hattip: «Schweiz: Höhere Arzneimittelausgaben durch Dispensierrecht», in: «Pharmazeutische Zeitung»