2 x pro Woche
Abonnieren Sie unseren Newsletter.
So sind die Schweizer Spitaldirektoren von heute
Im Schnitt 54 Jahre alt, fast immer mit Management-Studien – und auf Schleudersitzen arbeiten sie eigentlich eher selten: Dies besagen neue Daten über Herkunft und Ausbildung der Leute an den Spitzen unserer Spitäler.
, 28. September 2016 um 10:00


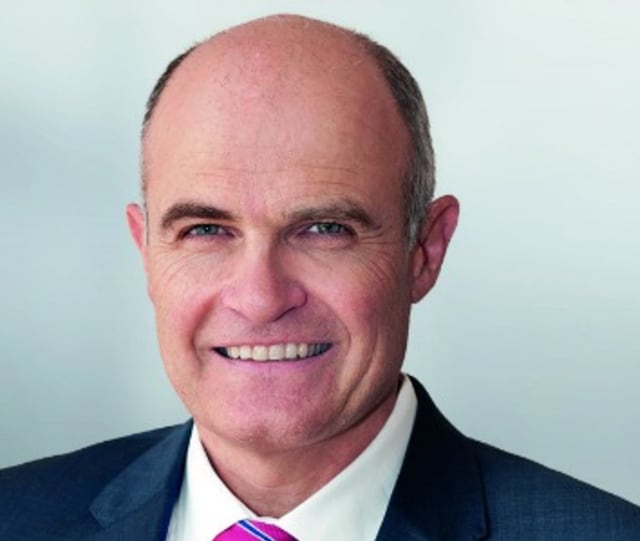

Teil 2: Magerer Frauenanteil in den Spital-Direktionen
Artikel teilen
Comment

HUG: Sieben Entlassungen wegen sexuellen Fehlverhaltens
Nach dem RTS-Film zu Missständen im Westschweizer Spitälern blieb eine neue #MeToo-Welle zwar aus. Das Genfer Unispital HUG zieht dennoch Konsequenzen.

Kleiner Trick mit Wirkung: Der Kopf-Kleber im Operationssaal
Wer im OP mitarbeitet, trägt einen bunten Kleber auf der Haube – mit Vorname und Hinweis zur Berufsgruppe. Eine deutsche Universitätsklinik schafft so mehr Klarheit und Teamgeist bei Operationen.

«Unsere Pflegekräfte sollen von der Umstellung profitieren»
Glen George, der Präsident der Vereinigung Zürcher Privatkliniken, erläutert den «Temporär-Stopp» im Kanton Zürich. Es sei denkbar, «dass dieser Schritt langfristig flächendeckend umgesetzt wird.»

Co-Creation im Gesundheitswesen
Zippsafe revolutioniert mit seinen Produkten das Gesundheitswesen. Ein platzsparendes Spindsystem optimiert Personalumkleiden, während ZippBag und ZippScan den Umgang mit Patienteneigentum verbessern. Erfahren Sie, wie die Produkte durch enge Zusammenarbeit mit Schweizer Spitälern entwickelt wurden.

Effiziente Desinfektion: Plastikfrei & nachhaltig
Die Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues bieten nachhaltige und effektive Desinfektion. Sie bestehen aus 100% plastikfreien Cellulosetücher und reduzieren CO₂-Emissionen um 25% pro Packung. Mit hoher Reissfestigkeit, grosser Reichweite und Hautverträglichkeit sind sie optimal für Hygiene und Umwelt.

Nachhaltig: Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues
HARTMANN erweitert sein Portfolio um die nachhaltigen Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues. Die Tücher werden aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und vereinen hohe Wirksamkeit, Materialverträglichkeit und Hautfreundlichkeit. Dabei werden Plastikabfall sowie CO₂-Emissionen reduziert.
Vom gleichen Autor

Überarztung: Wer rückfordern will, braucht Beweise
Das Bundesgericht greift in die WZW-Ermittlungsverfahren ein: Ein Grundsatzurteil dürfte die gängigen Prozesse umkrempeln.

Kantone haben die Hausaufgaben gemacht - aber es fehlt an der Finanzierung
Palliative Care löst nicht alle Probleme im Gesundheitswesen: … Palliative Care kann jedoch ein Hebel sein.

Brust-Zentrum Zürich geht an belgische Investment-Holding
Kennen Sie Affidea? Der Healthcare-Konzern expandiert rasant. Jetzt auch in der Deutschschweiz. Mit 320 Zentren in 15 Ländern beschäftigt er über 7000 Ärzte.