2 x pro Woche
Abonnieren Sie unseren Newsletter.
Covid-19: Das Kreuz mit der Immunität
Eine spannende Debatte steht an, im Zentrum die Frage: Wurde der Schutz der Bevölkerung gegen das «neue» Coronavirus unterschätzt?
, 23. September 2020 um 04:39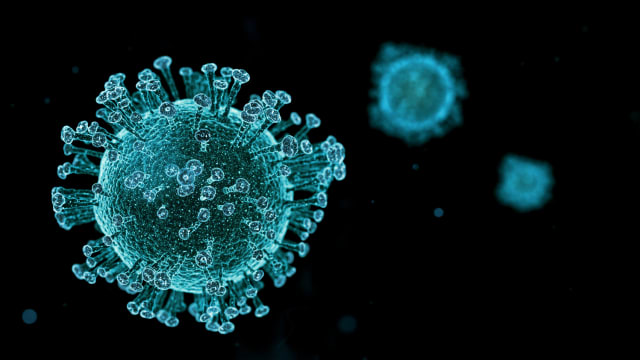
20 bis 50 bis 80 Prozent?
Schweiz spät…,
…Schweiz früh
«Ein gutes Gefühl»
Eine Antwort auf offene Fragen?
Stoff zum Thema:
- Swiss National Covid-19 Science Task Force: «SARS-CoV-2 infection-induced immune responses: meaningful immune protection?», 16. September 2020.
- Peter Doshi: «Covid-19: Do many people have pre-existing immunity?», in: «The BMJ», 17. September 2020.
- Pietro Vernazza: «Haben viele Menschen bereits eine Immunität gegen Covid?», in: «Infekt.ch», 20. September 2020.
- Ed Yong: «Immunology Is Where Intuition Goes to Die», in: «The Atlantic», 5. August 2020.
- Katherine J. Wu: «The Coronavirus Is New, but Your Immune System Might Still Recognize It», in: «New York Times», 6. August 2020.
- «What if herd immunity is closer than we thought?», in: «New York Times», 17. August 2020.
- David Wallace-Wells: «The Good (But Not Great) News About T-Cells and Herd Immunity», in: «New York Magazine», 19. August 2020.
- Sanjay Gupta, Andrea Kane: «Do some people have protection against the coronavirus?», in: CNN Health, 3. August 2020.
- Anna Waisman-Mentesh, Yel Dror, Ran Tur-Kaspa – Yariv Wine et al.: «SARS-CoV-2 specific memory B cells frequency in recovered patient remains stable while antibodies decay over time», Preprint medRxiv, 25. August 2020.
- Alessandro Sette, Shane Crotty: «Pre-existing immunity to Sars-Cov-2: the knowns and unknowns», in: «Nature Reviews Immunology», 7. Juli 2020.
- Beda M. Stadler, «Coronavirus: Warum alle falsch lagen», in: «Die Weltwoche», 10. Juni 2020.
- Alan Niederer: «Wie viel Kraft hat die Pandemie noch?», in: «Neue Zürcher Zeitung», 16. August 2020.
- Manuel Ansede: «Se está subestimando el porcentaje de población inmunizada frente a la covid», in: «El País», 20. August 2020.
- Angela Spelsberg, Ulrich Keil: «Astronomische Fehlrechnungen», in: taz, 12. August 2020.
Artikel teilen
Comment

Studie: Herzmedikament könnte Metastasen stoppen
Ein Forscherteam von ETH, USB, USZ und KSBL fand heraus, dass das etablierte Herzmedikament Digoxin bei Brustkrebs Metastasen verhindern könnte.

CHUV: Aus Spenderstuhl wird Medizin
Das Universitätsspital Lausanne ist das erste Schweizer Spital mit Swissmedic-Zulassung zur Herstellung eines Medikaments aus Fäkalbakterien.

BFS-Studie: Milliarden für Forschung und Entwicklung
2023 investierten Schweizer Privatunternehmen knapp 18 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung. Gesundheit bleibt der wichtigste Fokus.

Forschung und Praxis: Synergien für die Zukunft
Dr. Patrascu erklärt im Interview die Verbindung von Forschung und Praxis an der UFL. Er beschreibt die Vorteile des berufsbegleitenden Doktoratsprogramms in Medizinischen Wissenschaften und zeigt, wie die UFL durch praxisnahe Forschung und individuelle Betreuung Karrierechancen fördert.

Uni Bern: Professur für Klimafolgen & Gesundheit
Damit baut die Universität Bern ihre Forschung an der Schnittstelle von Präventivmedizin und Klimawissenschaften aus.

Onkologie-Patente: Europa lahmt, USA und China ziehen davon
Viele Ideen, wenige Durchbrüche: Europäische Firmen spielen eine Schlüsselrolle in der Krebsforschung – noch. Der alte Kontinent droht den Anschluss zu verlieren.
Vom gleichen Autor

Überarztung: Wer rückfordern will, braucht Beweise
Das Bundesgericht greift in die WZW-Ermittlungsverfahren ein: Ein Grundsatzurteil dürfte die gängigen Prozesse umkrempeln.

Kantone haben die Hausaufgaben gemacht - aber es fehlt an der Finanzierung
Palliative Care löst nicht alle Probleme im Gesundheitswesen: … Palliative Care kann jedoch ein Hebel sein.

Brust-Zentrum Zürich geht an belgische Investment-Holding
Kennen Sie Affidea? Der Healthcare-Konzern expandiert rasant. Jetzt auch in der Deutschschweiz. Mit 320 Zentren in 15 Ländern beschäftigt er über 7000 Ärzte.