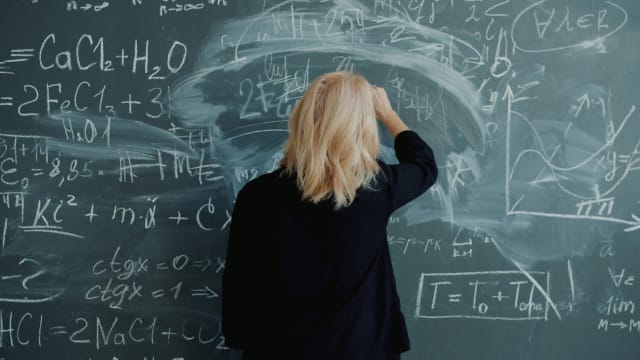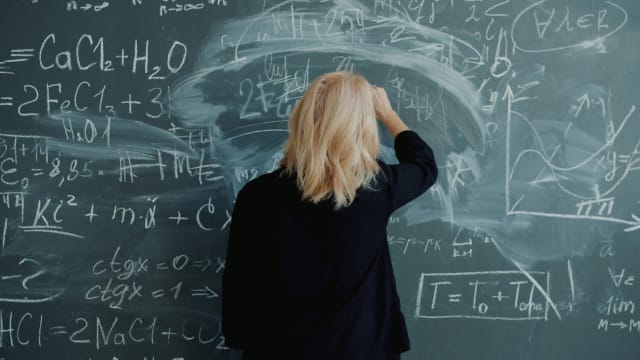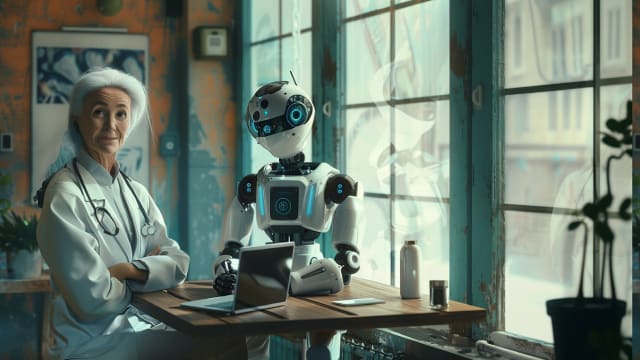Herr Bachofner, seit Jahren hören wir, dass es mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen harzt. Aber ist das wirklich der Fall?
Betrachtet man die einzelnen Leistungserbringer – etwa die Ärzte, die Spitäler –, so wurden schon viele Fortschritte erzielt. Natürlich kann man anmerken, dass noch nicht 100 Prozent der Akteure voll digitalisiert sind. Aber in vielen Ärztepraxen ist es heute selbstverständlich, dass vollständig elektronische Krankengeschichten geführt werden – insbesondere in Gruppenpraxen und Spitälern.
Wo liegt also das Problem?
Die Vernetzung der Teilnehmer untereinander gestaltet sich schwieriger. Hier haben wir unterschiedliche Stakeholder mit heterogenen Interessen und heterogenen Systemen. Aber auch da ist der Trend klar: Die Geschwindigkeit bei der Vernetzung steigt deutlich. Das Thema ist auf der Agenda, es ist in den Budgets, und der Nutzen wird von den meisten erkannt.
Thomas Bachofner ist seit Dezember 2016 CEO von
Swisscom Health. Der 46-jährige Digitalisierungsprofi war zuvor Leiter Strategie für das KMU-Segment bei der Swisscom; davor arbeitete er unter anderem für IBM und Accenture. Bachofner studierte an der Universität Bern Ökonomie und Politikwissenschaften. — Swisscom Health ist die für Betreuung der Gesundheitsbranche zuständige Einheit des Telecom-Konzerns. Zu ihren Kunden gehören heute rund 3500 Ärzte und 200 Spitäler.
Befinden wir uns also an einem Punkt, wo es jetzt dann bald sehr rasch geht?
Das Bewusstsein vieler Beteiligter im Gesundheitswesen hat bereits eine kritische Schwelle überschritten, auch was das Potenzial ihrer Vernetzung untereinander betrifft. Derzeit merken wir, dass die Durchsetzung des elektronischen Patientendossiers ein zusätzliches Momentum in die Vernetzungsdiskussion bringt.
Die Aussicht, dass die Spitäler und Kliniken ab 2020 ein EPD anbieten müssen, löst also jetzt schon Bewegung aus?
Ja, denn die Zeit für die Umsetzung der dafür nötigen komplexen Projekte ist knapp. Zudem setzen sich die Leistungserbringer über das EPD hinaus mit dem Potenzial der Vernetzung auseinander: Sie prüfen, welche Vorteile und Möglichkeiten sich ihnen damit eröffnen. Dabei erkennen sie, dass sie durch die Digitalisierung von Prozessen zwischen Leistungserbringern an Effizienz gewinnen und Aufwand reduzieren können.
Und welche Digitalisierungs-Fragen beschäftigen die Praxis-Ärzte am intensivsten?
Es gibt unterschiedliche Kategorien. Wer in einer Gruppenpraxis tätig ist, arbeitet ohnehin digitalisiert mit elektronischen Krankengeschichten, um einen reibungslosen internen Austausch sicherzustellen. In diesen Praxen geht es aktuell um den digitalen Informationsaustausch mit anderen Leistungserbringern und Patienten.
«Ein solcher Entschluss erhöht die Chancen, die Praxis dereinst zu attraktiven Konditionen übergeben zu können»
Bei den Hausärzten in Einzelpraxen ist es anders: Sie arbeiten zur Hälfte noch nicht mit elektronischen Krankengeschichten. Hier muss es also erst Teil der Arbeitsweise werden, dass alles elektronisch dokumentiert werden kann oder dass auch weitere Praxisprozesse digitalisiert werden können.
Wie würden Sie – in den entscheidenden Punkten – gegenüber einem Arzt die grössten Vorteile einer vollständigen Digitalisierung herausstreichen?
Wer langfristig denkt, effizient arbeiten will, auf hohe Sicherheit setzt und sich auch bei seinen Patienten positionieren will, wird in seiner Praxis und im Austausch mit anderen Akteuren – auch – auf digitale Prozesse setzen. Kommt dazu: Ein solcher Entschluss erhöht die Chancen, die Praxis dereinst zu attraktiven Konditionen übergeben zu können.
Aber viele befürchten, erst umständlich etwas installieren zu müssen – und am Schluss doch mehr Arbeit zu haben.
Diese Sorgen nehmen wir ernst und beweisen täglich das Gegenteil. Hinzu kommt bei gewissen Ärzten wohl die latente Sorge, dass man an Kontrolle verliert, wenn etwa das EPD für Patienten und andere Leistungserbringer mehr Transparenz in vorhandene Gesundheitsinformationen bringt.
Dazu gab es unlängst einen Bericht aus einem deutschen Klinikum: Die Ärzte sehen auf ihren Tablets alle nötigen EPDs inklusive Röntgenbildern und Warnhinweisen. Jetzt fühlen sie sich verpflichtet, sich ständig um diese Warnhinweise zu kümmern. Ohne das konkrete Problem zu kennen: Der Fall zeigt einerseits, dass digitalisierte Tools bereits heute zur Arbeit in den Praxen und Spitälern gehören. Andererseits macht er deutlich, dass diese Tools und der Umgang mit ihnen – wie bei analogen Methoden auch – laufend verbessert werden müssen. Bemerkenswert ist, dass in der besagten Studie 92 Prozent der Befragten angeben, digitale Technik erleichtere ihren Alltag.
«Die Einstellung zum Fortschritt wird stark geprägt vom Nutzen, den man davon hat»
Aber etwas wird mit dem EPD gewiss hinzukommen – nämlich Fragen der Patienten zum Dossier. Also muss noch geklärt werden, wie man damit umgeht, zum Beispiel, wie die Ärzte diese Fragen und Beratungen abrechnen können.
Ein anderer Punkt der Skeptiker ist der Datenschutz: Da drohten Lücken und Geheimnisverletzungen. Trügt das Gefühl, dass der Datenschutz oft vorgeschoben wird, weil man einfach Aufwand befürchtet?
Was den Datenschutz betrifft, müssen wir Unsicherheiten und Ängsten absolut Rechnung tragen. Datenschutz hat im Gesundheitswesen höchste Priorität – ob bei digitalen Daten oder Papierakten. Wenn die Leistungserbringer befürchten, dass die Datenerfassung ihnen am Ende mehr Arbeit bereitet, und sie damit rechnen, dass sie mehr Beratung benötigen, stehen wir in der Pflicht. Es ist an uns als Lösungsanbieter, ihnen den Nutzen der Digitalisierung überzeugend aufzuzeigen.
Aber es ist doch eigenartig: Seit zwei Jahrzehnten sind unsere Bankkonten elektronisch, dabei sind Bankdaten ähnlich brisant und intim wie Gesundheitsdaten. Wo ist der Unterschied?
Die Einstellung zu solchen Fortschritten wird stark geprägt vom Nutzen, den man davon hat. Vor 10 oder 15 Jahren waren Sie bezüglich eBanking bestimmt auch noch skeptischer. Aber Online-Transaktionen vereinfachten das Leben enorm, eBanking brachte den Usern mehr Transparenz, und am Ende fanden alle: Das ist eine gute Sache. Inzwischen hat jeder seine Erfahrungen mit elektronischen Banktransaktionen.
«Das Kundenerlebnis wird für die Patienten ein ganz wichtiger Hebel sein, damit sich das EPD durchsetzt»
Aber seit wann kann ich als Bürger auf meine Gesundheitsdaten zugreifen und mit ihnen etwas Sinnvolles anfangen? Smartwatches mit Gesundheitsdaten oder Fitness-Apps gibt es erst seit wenigen Jahren. Hier haben wir gegenüber dem Banking noch einige Jahre aufzuholen. Ein anderer Unterschied liegt in der Marktstruktur. Das Gesundheitswesen ist vielfältiger als die Finanzbranche…
Es gibt ein paar hundert Spitäler und tausende Arztpraxen, aber keine so grossen Konzerne wie UBS oder Credit Suisse.
Und es kommt noch etwas hinzu: Als Kunde hat man mit seiner Bank stets eine bilaterale Eins-zu-eins-Beziehung. Bei Gesundheitsfragen hat man aber fast immer gleich mehrfache Beziehungen: Sie korrespondieren mit dem Arzt, der Krankenkasse, vielleicht mit einer Therapeutin, der Apotheke – und so weiter. Da kann der Eindruck eines diffusen Beziehungsgeflechts entstehen. Transparente und sichere Lösungen schaffen hier das nötige Vertrauen.
Wie verführt man die Bürger dazu, sich um ihr EPD zu bemühen, sich damit anzufreunden, sich darum zu kümmern?
Es braucht keine Verführung, es braucht konkreten und überzeugenden Nutzen. Das Kundenerlebnis wird für die Patienten ein ganz wichtiger Trigger sein, damit sich das EPD und die Digitalisierung im Gesundheitswesen generell durchsetzen. Die eingesetzten Tools müssen mit Applikationen mithalten können, die wir auch in anderen Lebensbereichen gerne nutzen – sonst brauchen sie nur diejenigen, die sie zwangsweise einsetzen müssen.
Aber was sind die Eintrittspforten?
Es gibt typische Use-Cases, bei denen der Nutzen eines EPD augenfällig ist: Wer zum Beispiel für Kinder oder für Eltern sorgt, kann wichtige Informationen elektronisch sicher und einfach teilen. Oder wer die immer zahlreicheren digitalen Services rund um die Gesundheit nutzen will – ob in Richtung Medizin, Wellness, Gesundheitskompetenz, Fitness, Ernährung – wird ein persönliches digitales Dossier für diese Informationen schätzen. Diese Dienstleistungen und der erlebbare Nutzen werden ausschlaggebend dafür sein, dass man sein digitales Gesundheitsdossier nicht mehr wird hergeben wollen.