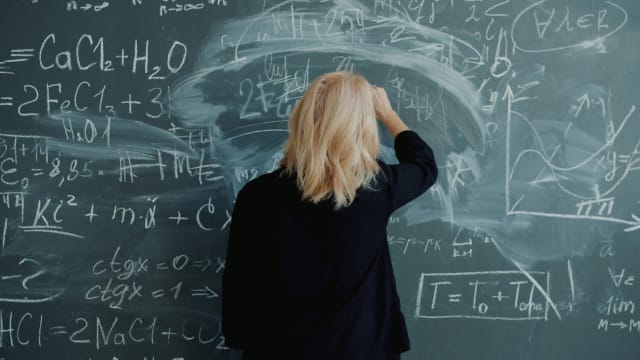Herr Fantacci, Ihre Berufserfahrung umspannt mehr als ein Vierteljahrhundert: Was war in dieser Zeit der wichtigste Fortschritt für die Hausärzte?
Was definitiv besser wurde, ist die Diagnostik. Wir sind heute viel sicherer in der Beurteilung: CTI, Ultraschall, MRI – das sind enorme Fortschritte. Vor dreissig Jahren war man mit viel mehr Unsicherheit behaftet. Im Berufsstand allgemein scheint mir der Trend zur Gruppenpraxis wichtig. Es ist eine grosse Bereicherung.
Und was war die fatalste Entwicklung?
Die Einführung des Numerus Clausus. Das führte dazu, dass viel weniger Ärzte ausgebildet wurden – und dem verdanken wir die jetzige Lage.
Man löst es, indem man Leute aus dem Ausland holt.
Das ist fatal. Die Schweiz bedient sich einfach. Bislang waren es viele Deutsche, das wird jetzt aber auch schwieriger, da die Löhne dort gestiegen sind.
Giovanni Fantacci führt eine Praxis in Niederhasli. Er schloss sein Medizinstudium 1989 ab und gründete seine Praxis im Zürcher Unterland 1997 nach Weiterbildungen in der Schweiz und Italien. Sein neues Buch
«Hausarzt 4.0. Ein Plädoyer für die Hausarztmedizin» (Edition Gai Saber) ist auch ein Plädoyer für die Hausarztmedizin.
Eine andere Dauerklage heute betrifft die bürokratische Belastung. Um welchen Faktor hat sich der administrative Aufwand erhöht, seit Sie in den Arztberuf eingestiegen sind?
Ich hatte schon ganz zu Beginn im Spital sehr viel damit zu tun. Was massiv zugenommen hat, ist die staatliche Überwachung. Wir müssen jährlich Befragungen und Statistiken ausfüllen, wir haben eine Qualitätsbeauftragte in der Praxis – eine MPA beschäftigt sich nur mit dem Qualitätsmanagement. Wir mussten in den letzten Jahr vier Ordner Papier produzieren zu Qualitätsfragen: Labor, Abläufe beschreiben, Zuweisungen… Ich bin nicht sicher, wo da der Benefit für die Patienten ist.
Auch die Krankenkassen wollen immer mehr Berichte.
Hier geht es noch. Wenn wir mehr Papier produzieren, dann müssen sie auf der Gegenseite das Zeug auch lesen. Beim BAG ist die Zahl der Stellen in den letzten zwanzig Jahren explodiert, und diese Leute müssen beschäftigt werden. Bei den Krankenkassen war das nicht so stark.
Oft heisst es, dass die Patienten verstärkt eine Konsumhaltung haben. Entspricht das Ihrer langfristigen Erfahrung?
Man kann es diskutieren. Teils habe ich schon das Gefühl, dass die Leute mit einer Einkaufsliste zu uns kommen, als ob wir die Migros oder Coop wären. Das muss man dann auch debattieren.
Geht das über Einzelfälle hinaus?
Es gibt einen Trend in diese Richtung. Man will alles und sofort – mit dem Motto, dass man ja dafür bezahlt. Auch die MPA sagen mir, dass Sie solchen Druck verspüren.
«Als ich im Unispital auf der Chirurgie war, gab es einen Assistenzarzt, der gar keine Wohnung mehr hatte – nur noch sein Auto.»
Auch da zeigt sich also: Vertrauen und Vertrauensbildung sind sinkende Währungen.
Kann man so sagen. Das Internet bietet so viele Möglichkeiten, sich unabhängig vom Arzt zu informieren; aber die Antworten sind halt nicht differenziert.
Was würden Sie Ihrem jungen, frisch staatsexaminierten Ich nach Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung heute raten?
Bleib neugierig. Lass dich nicht in eine Routine drängen. Lass sich immer auf eine Beziehung ein zu den individuellen Patienten. Und höre dabei zu. Es gibt Kollegen, die sich ja auch belästigt fühlen von den Patienten – «Jetzt kommt der schon wieder» –, und da sollte man eine gewisse Leichtigkeit entwickeln. Auch indem man das Gespräch sucht und fragt: «Warum kommen Sie immer wieder damit? Was beschäftigt Sie?»
Sie konfrontieren die Patienten also.
Ja. Da bin ich relativ direkt.
Viele angehende Mediziner sind nicht mehr bereit, überdurchschnittliche Arbeitszeiten hinzulegen. Ihr Kommentar?
Als ich im Unispital auf der Chirurgie war, gab es einen Assistenzarzt, der gar keine Wohnung mehr hatte – nur noch sein Auto. Er war die ganze Zeit im Spital und wartete darauf, dass er operieren kann. Dorthin muss man sicher nicht zurück. Aber es ist auch nicht sinnvoll, den Arztbesuch zu reglementieren in einem gewerkschaftlichen Sinne mit fix festgelegten Arbeitsstunden. So macht man den Beruf auch kaputt. Dieser Beruf ist immer auch eine Berufung. Und solch eine Berufung kann man nicht einfach gewerkschaftlich eingrenzen, sondern dazu gehört, dass man teilweise mehr Zeit investiert. Wenn die Work-Life-Balance so einseitig ist, dass Work nur noch als Belastung gesehen wird, dann ist es eine Verarmung des Lebens. Arbeit gehört genauso zum Leben.
Arbeiten Sie noch zu 100 Prozent?
Seit zwei Jahren nehme ich am Donnerstag frei. Den Tag nutzte ich dann eben, um das Buch zu schreiben.
Vielen Hausärzten macht die Nachfolge-Suche Sorgen. Ihnen nicht?
Nein. Meine Einzelpraxis hat sich stetig ausgebaut, indem ich Ärzte aufnahm, die hier einen Teil ihrer Ausbildung gemacht hatten. Und vor zwei Jahren wandelten wir das dann in eine AG um.