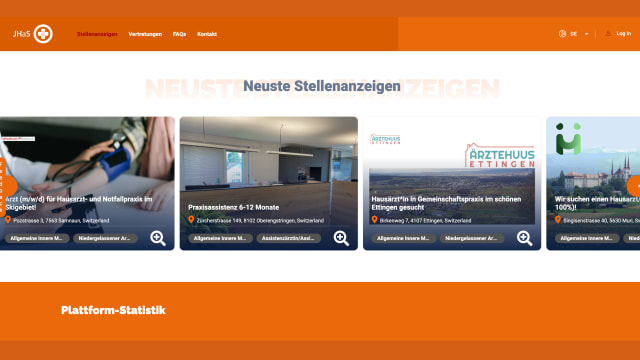Es war ein interessantes Experiment. Ein Experiment, welches das Verhältnis zwischen Patienten und Institutionen schön auf den Punkt brachte. Die Wissenschaftlerin Sophia Schlette von der
Stiftung Gesundheit in Hamburg und Berlin zeigte auf, was man alles unterm Suchbegriff «Patientenportal» findet – respektive mit dem englischen Begriff
«patient portal».Am Ende endet man in ganz verschiedenen Denkwelten: Dies ein starker Eindruck der Darstellung von Schlette an der
Healthcare & Branding Conference, die soeben in Zürich stattfand.
Denn wer nach einem «patient portal» googelt, der stösst auf Seiten, von denen aus er beispielsweise Arzttermine buchen oder sich für Lehrveranstaltungen anmelden kann. Er stösst, kurz gesagt, auf interaktive Angebote.
«Nicht eines, bei dem es um Interaktion geht»
Wer dasselbe auf Deutsch tut, der findet zahlreiche Angebote, die sich zwar «Patientenportale» nennen – aber lediglich zu Informationen führen: Fakten, Daten, Adressen, Strukturen.
Doch im deutschen Sprachraum «finden Sie nicht eines, wo es um die Interaktion zwischen Patient und Leistungserbringer geht», so die Gesundheits-Forscherin aus Berlin: Zum Austausch diene bestenfalls ein Link, über den man dann jemanden anmailen darf.
Sophia Schlette von der Stiftung Gesundheit an der Healthcare & Branding Conference in Zürich (Bild: Peter Brandenberger)
Was ist ein gutes Patientenportal? Dies die implizite Frage von Sophia Schlette, die unter anderem in Harvard geforscht und für Kaiser Permanente in den USA gearbeitet hatte. Gut, so ihre These, sind Portale, welche die Pateinten stark einbeziehen und nicht nur paternalistisch informieren.
Ein Beispiel dafür bietet die
Mayo-Klinikkette: Deren Patientenportal liefert einerseits Infos über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten oder Medikamente – aber gleich nebendran ermöglicht es auch, einen Arzttermin zu vereinbaren oder ein persönliches Gesundheitsdaten-Konto einzurichten.
Alltagsfragen, Rezepte, Rechnungen – alles zusammen
Ein weiteres Beispiel, das genannt wurde, war
«My Health Manager» des grossen US-Gesundheitsversorgers Kaiser Permanente. Von diesem Portal aus kann man beispielsweise Ärzte mit Alltagsfragen angehen, die eigenen Rezepte speichern, sein Patientendossier einrichten und verwalten und am Ende sogar seine medizinischen Rechnungen bezahlen.
Nun ist es ja fast eine Binsenwahrheit, dass das Verhältnis zwischen Medizinern und Patienten künftig viel stärker zweiseitig beziehungsweise mehrgleisig verlaufen wird. Das kleine Experiment von Sophia Schlette führte dies einfach in einem konkreten Feld vor Augen. Ähnlich deutlich wurde die Verschiebung bei einem weiteren Auftritt an der Healthcare & Branding Conference: Florian Weiss, der Geschäftsführer von Deutschlands grösster
Arzt-Empfehlungs-Site Jameda, stellte klar, dass der Wandel unaufhaltsam kommen wird – und wohl auch recht rasch.
«In der Zukunft wird kein Patient einen Arzt aufsuchen, ohne sich vorher im Internet über die Qualität des Arztes und über seine Krankheit informiert zu haben», prophezeite Florian Weiss in Zürich. Und auch die Kontaktaufnahme werde überwiegend online erfolgen.
Florian Weiss, Geschäftsführer Jameda (PD)
Dass Deutschland auf dem Weg zum web-vernetzten und web-bewerteten Arzt bereits ein Stück weiter ist, zeigen einige Zahlen zu Jameda: 270'000 Ärzte finden sich dort, 5 Millionen Patienten informieren sich jeden Monat auf der Seite, das Wachstum im letzten Jahr betrug 60 Prozent.
Das Prinzip ist dabei klar:
- Jeder niedergelassene Arzt in Deutschland soll auf Jameda aufgeführt sein.
- Wer etwas bezahlt, kann seine Praxis detaillierter präsentieren und ein Terminbuchungs-Tool einrichten.
- Zugleich haben die Patienten die Möglichkeit, die Ärzte zu bewerten.
- Und dabei soll ein Prüf-Algorithmus dafür sorgen, dass die Bewertungen authentisch sind.
Natürlich weckt das «Tripadvisor»-Prinzip berechtigte Befürchtungen. Jameda-Chef Florian Weiss aber versuchte zu entwarnen: 70 bis 80 Prozent der Bewertung auf seinem Beurteilungs-Portal seien positiv. «Wer Ärzte bewertet, hat ein anderes Motiv als bei einem Hotel. Ärzte werden aus dem Motiv Dankbarkeit bewertet – und auch, weil man selber helfen will.»
Deshalb würden die Patienten mehrheitlich konstruktive Kritik anbringen.
Wer Zweitmeinungen will, will sie online
Wie verbreitet der Wunsch nach digitaler Flexibilität bei den Patienten ist, deutete ein weiterer Redner an der Zürcher Healthcare & Branding Konferenz an: Es war Richard Etter, einer der Gründer der Schweizer Plattform
«Meine Zweitmeinung».
Denn dieses Angebot zur effizienten Einholung von Zweitmeinungen sieht explizit vor, dass Patienten wie Ärzte einen Besuch arrangieren können – oder auch einen brieflichen Kontakt. Aber 89 Prozent der über «Meine Zweitmeinung» eingeholten Stellungnahmen werden online bestellt und gemacht. «Effizienz und zeitliche Flexibilität sind hier offenbar sehr wichtig», so Richard Etter.
Dass der Wandel, wie schon von den Vorrednern angetönt, wohl bald an Tempo zulegen könnte, zeigte sich in einem Detail, das Richard Etter verriet: Bereits 15 Prozent der Nutzer von «Meine Zweitmeinung» sind über 65 Jahre alt.
Sieht also ganz so aus, als die Digitalisierung nicht erst mit dem Wandel zu einer jüngeren Generation durchgesetzt wird.