2 x pro Woche
Abonnieren Sie unseren Newsletter.
Gehälter im Gesundheitswesen: Das 333-Franken-Rätsel
Geht es um gleiche Löhne für Mann und Frau, so steht die Gesundheitsbranche besser da als andere. Sehr ermutigend ist die Lage trotzdem nicht.
, 24. August 2015 um 05:21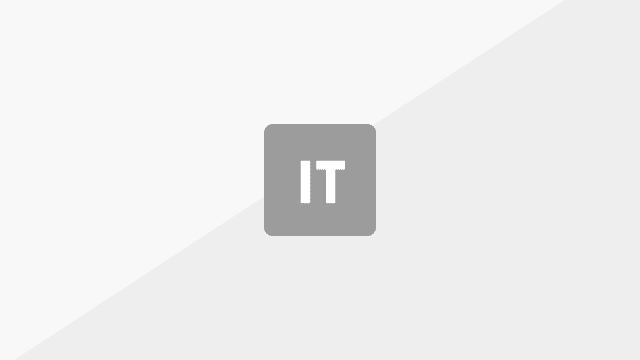
Tiefes Lohnniveau – mehr Gleichheit
Bundesamt für Statistik: «Löhne, Erwerbseinkommen: Indikatoren Lohnniveau nach Geschlecht»
Weiterbildung, Erfahrung, Hierarchie – und dann?
55 Franken in sechs Jahren
Artikel teilen
Comment

Pflege: Erste Klinik führt 37-Stunden-Woche ein
Das Sanatorium Kilchberg erhofft sich vom Stundenabbau im Schichtdienst stabilere Teams – und weniger offene Stellen.

Freiburg: Radiologie-Techniker beklagen unfaires Vorgehen
Die Radiologiefachleute des Freiburger Spitals fechten ihre Lohneinstufung weiter an. Die Bewertungskommission sei ungerecht zusammengesetzt.

Teilzeit im Spital: Flexibilität ist alles – bei der Kinderbetreuung
Teilzeitarbeit ist längst ein zentraler Faktor für Spitäler und Gesundheitsbetriebe. Mit weitreichenden Folgen.

HUG: Sieben Entlassungen wegen sexuellen Fehlverhaltens
Nach dem RTS-Film zu Missständen im Westschweizer Spitälern blieb eine neue #MeToo-Welle zwar aus. Das Genfer Unispital HUG zieht dennoch Konsequenzen.

«Unsere Pflegekräfte sollen von der Umstellung profitieren»
Glen George, der Präsident der Vereinigung Zürcher Privatkliniken, erläutert den «Temporär-Stopp» im Kanton Zürich. Es sei denkbar, «dass dieser Schritt langfristig flächendeckend umgesetzt wird.»

Ärztegesellschaft sucht Ideen für bessere Work-Life-Balance
Wie bringen Mediziner ihren Beruf und ihr Privatleben besser in Einklang? Um neue Lösungen zu finden, startet die AGZ ein Pilotprojekt mit zwölf Praxen und einer spezialisierten Fachstelle.
Vom gleichen Autor

Überarztung: Wer rückfordern will, braucht Beweise
Das Bundesgericht greift in die WZW-Ermittlungsverfahren ein: Ein Grundsatzurteil dürfte die gängigen Prozesse umkrempeln.

Kantone haben die Hausaufgaben gemacht - aber es fehlt an der Finanzierung
Palliative Care löst nicht alle Probleme im Gesundheitswesen: … Palliative Care kann jedoch ein Hebel sein.

Brust-Zentrum Zürich geht an belgische Investment-Holding
Kennen Sie Affidea? Der Healthcare-Konzern expandiert rasant. Jetzt auch in der Deutschschweiz. Mit 320 Zentren in 15 Ländern beschäftigt er über 7000 Ärzte.